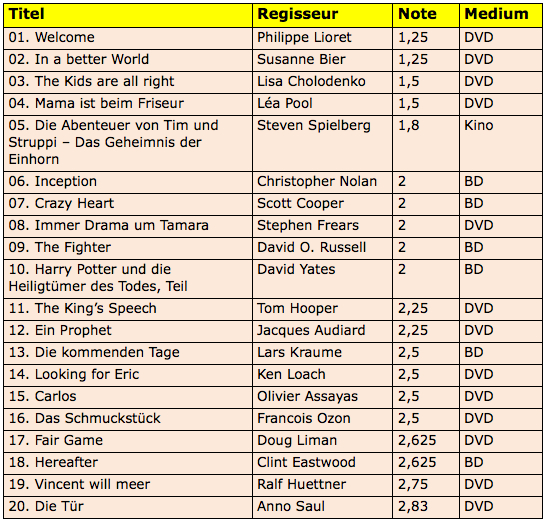USA 2011 - Regie: Clint Eastwood - Darsteller: Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Josh
Lucas, Judi Dench, Damon Herriman, Ken Howard, Jeffrey Donovan, Ed Westwick - Prädikat: besonders wertvoll - FSK: ab 12 -
Länge: 136 min.
Die 1960er Jahre. In einem
Gespräch mit einem Beamten fragt der US-Justizminister Robert F. Kennedy: „Weiß
der Direktor über die Sache Bescheid?“ Sein Gesprächspartner blickt vielsagend
zur Decke und erwidert: „Ich vermute, jetzt weiß er Bescheid“, worauf Kennedy
rief: „Edgar, kannst Du mich hören?“
Edgar – gemeint war John
Edgar Hoover, seit 1924 Chef des Bundeskriminalamtes, des so genannten
"Federal Bureau of Investigation" (FBI). Und die Vermutung, dass der
seit fast vier Jahrzehnten ununterbrochen amtierende FBI-Boss das Büro seines
Dienstherrn verwanzt haben könnte, war sicher kein ironischer Scherz.
FBI-Chef
Hoover befiehlt zu diesem Zeitpunkt über 16 200 Angestellte -- darunter 7000 gut
ausgebildete Sonderagenten. In seinem Washingtoner Hauptquartier verwahrt er
Dossiers über Hunderttausende von US-Bürgern. Das Fingerabdruck-Archiv seiner
Behörde ist die größte kriminaltechnische Identifizierungs-Kartei der Welt. Und
schließlich sind da noch die vertraulichen Akten, in denen Hoover besondere
Erkenntnisse verwahrte, am liebsten solche, die aus den verwanzten
Schlafzimmern der Mächtigen stammten. Erkenntnisse, die Hoover möglicherweise
zum einflussreichsten Strippenzieher der Vereinigten Staaten gemacht haben.
In Clint
Eastwoods „J. Edgar J.“ wird Hoover (Leonardo DiCaprio) jedem neu gewählten
US-Präsidenten einen Antrittsbesuch abstatten. Und jedes Mal wird er vor dem
Betreten des Büros kurz stehenbleiben und einen Blick auf ein Portrait George
Washingtons werfen. Dann betritt er den Raum, in seiner Hand eines der
berüchtigten Dossiers, deren Inhalt dafür sorgte, dass Hoover acht Präsidenten
und 16 Justizminister politisch überleben konnte, bevor den 77-jährigen 1972
ein Herzschlag ereilte.
Großartiger Schauspielerfilm
Wie geht man mit einem Mann
um, der vermutlich über jahrzehntelang seine obersten Dienstherren erpresste
und nötigte und die politische Kultur des USA nachhaltig beschädigte, während
er sein Privatleben hinter der Fassade eines biederen Bürgers verbarg, der
höchstens einmal im Jahr Urlaub macht und ansonsten rund um die Uhr arbeitet?
Behält man den Blick für das
Faktische oder man setzt auf ein spekulatives Psychodrama. War Edgar J. Hoover ein
gefährlicher „Big Brother“, der einen Schnüffelstaat im Visier hatte, oder
lenkte er seine Energien in seine Arbeit, um seine heimliche Homosexualität zu
kompensieren. Und vor allen Dingen: wen interessiert das?
„J. Edgar“ ist zunächst ein fesselnder
Schauspielerfilm. Der auf Zwanghaftes und Morbides fast schon
überspezialisierte Leonardo DiCaprio gibt nach einem mitreißendem Portrait des
zwangskranken Howard Hughes nun auch eine exzellente Vorstellung vom Innenleben
eines nicht weniger getriebenen Mannes, dessen Vita auch eine Herausforderung
für die Maskenbildner gewesen sein dürfte.
In der Besetzung der
Hauptrolle spiegeln sich die Stärken, aber auch die kritischen Momente in Clint
Eastwoods Film, denn DiCaprio bleibt am Ende doch DiCaprio, ein Schauspieler,
der es zwar versteht, den inneren Dämonen eines verdrängten Lebens Ausdruck zu
verleihen, dem man aber über weite Strecken nicht immer das Brutal-Ruppige des
echten Hoover abkaufen mag, der von Zeitgenossen aufgrund seines Äußeren auch
Bulldogge genannt wurde. Manchmal hat man in „J. Edgar“ sogar das Gefühl, dass
in DiCaprios Acting doch eine Spur zuviel Empathie und Differenzierungsvermögen
wirken, um das Exemplarische an Hoovers Paranoia adäquat herauszuarbeiten.
Doch dann folgen Szenen, in
denen kleine Gesten und Veränderungen der Mimik präzise herausarbeiten, dass
wir einem Mann zuschauen, der ein bis zur Erstarrung durchgeplantes Leben mit
genauso starr geplanter Intimität aufladen will, wobei ihm dies in den
entscheidenden Moment immer wieder missrät.
Das hätte zumindest eine
OSCAR-Nominierung verdient, aber „J. Edgar“ ist von den Juroren komplett
ignoriert worden, was vielerlei Schlüsse zulässt.
Eastwood und sein
Drehbuchautor Dustin Lance Black („Milk“) haben in „J. Edgar“ eine elegante,
aber nicht immer restlos überzeugende Lösung für das Problem gefunden, wie man
Privates und Politisches unter einen Hut bekommt. Hoovers Leben wird in zwei
Zeitschienen gepackt, die mäandernd ineinander greifen, ohne dabei den narrativen
Zusammenhang zu verlieren, und ganz am Ende werden wir sehen, dass aus naiver
Faktentreue und vordergründigem Realismus kein gutes Biopic entsteht, weil der
Fake als immanenter Bestandteil des Konstruierens und Dekonstruierens immer
eine wichtige Rolle spielt. Clint Eastwood und sein Autor haben dieses Problem,
das uns bereits in Orson Welles „Citizen Kane“ begegnet ist, jedenfalls adäquat
gelöst und aus gutem Grunde mit ihrer Plotstruktur mächtige Löcher in Hoovers
Biografie gerissen.
Ohne historische Kenntnisse etwas sperrig
Prolog und Rahmenhandlung
spielen in einem Zeitraum, der nach der Kubakrise beginnt, die Ermordung John
F. Kennedys und Martin Luther Kings einschließt und mit Hoovers Tod endet: hier
sehen wir den alten Hoover, der verschiedenen jungen FBI-Beamten sein ganz
persönliche Sicht der geschichtlichen Ereignisse diktiert, eine Autobiographie,
die so nie existierte, und wir hören ihn als sein eigener Erzähler aus dem Off.
Die eingeschobenen
Flashbacks beziehen sich dagegen auf einen Zeitraum, der 1919 mit dem Bombenattentat
auf den Attorney General (was in etwa unserem Generalstaatsanwalt entspricht)
Alexander Mitchell Palmer beginnt und mit der Überführung Bruno Richard
Hauptmanns, des vermeintlichen Entführers des Lindbergh-Babys, endet. Diesen
spektakulären Fall wusste Hoover geschickt zu nutzen, um seiner Behörde
endgültig zum Durchbruch zu verhelfen: 1935 wurde das Bureau of Investigation (BOI) in das Federal Bureau of Investigation (FBI) umbenannt, das nunmehr
übergreifende Befugnisse besaß.
Ohne historische Kenntnisse
erweist sich der Film in den ersten 60 Minuten als durchaus sperrig. „J. Edgar“
findet zunächst kurze, aber prägnante Bilder für öffentliche Hysterie, die als
„Red Scare“ bekannt wurde, jene rote Angst, die in der McCarthy-Ära erneut
hochschwappte und sich bereits 1917 zum ersten Mal offen zeigte. Nach der
russischen Oktoberrevolution wurden linke Kriegsgegner, die gegen den Eintritt
der USA in den 1. Weltkrieg demonstrierten, aber auch amerikanische
Kommunisten, Anarchisten und natürlich auch die Gewerkschaften zur Zielscheibe.
Eastwood lässt Hoover in
seinen Erinnerungen gleich zu Anfang als einen Mann auftreten, der als
patriotischer Mitarbeiter des US-Justizministeriums nicht davor zurückschreckt,
die nicht verfassungsgemäße Deportierung einer US-Bürgerin zu betreiben, der
bekannten Ikone der amerikanischen Friedensbewegung Emma Goldman. Dieser Coup
war tatsächlich keineswegs Hoover allein zuzuschreiben, obwohl er mit diesem
einen Anteil an den berüchtigten „Palmer-Raids“ hatte, die zur Deportation von
über 10.000 politisch Unerwünschten in die Sowjetunion führte. Die meisten wurden später Opfer der stalinistischen Säuberungsaktionen.
Diese zwar etwas verkürzte, aber im Kern korrekte Wiedergabe der Fakten ist Eastwoods Film hoch anzurechnen, man sollte aber schon etwas über die Hintergründe wissen, um Hoover in der sehr gespaltenen politischen Kultur dieser Jahre richtig zu verorten. Tatsächlich wurden die USA Anfang des vergangenen Jahrhunderts von Terroranschlägen erschüttert, die Linken und Anarchisten angelastet wurden und das Rechtsverständnis der Nation belasteten – gelinde gesagt. Hoover gehörte wohl aus ideologischen Gründen zum rechten Lager. Dies sollte man wissen, um nicht der verkürzten These zu erliegen, dass Triebabfuhr mit politischer Radikalität korreliert wird und private Macken hinreichend die folgende Monstrosität erklären.
Diese zwar etwas verkürzte, aber im Kern korrekte Wiedergabe der Fakten ist Eastwoods Film hoch anzurechnen, man sollte aber schon etwas über die Hintergründe wissen, um Hoover in der sehr gespaltenen politischen Kultur dieser Jahre richtig zu verorten. Tatsächlich wurden die USA Anfang des vergangenen Jahrhunderts von Terroranschlägen erschüttert, die Linken und Anarchisten angelastet wurden und das Rechtsverständnis der Nation belasteten – gelinde gesagt. Hoover gehörte wohl aus ideologischen Gründen zum rechten Lager. Dies sollte man wissen, um nicht der verkürzten These zu erliegen, dass Triebabfuhr mit politischer Radikalität korreliert wird und private Macken hinreichend die folgende Monstrosität erklären.
Clint Eastwood orientiert
sich der Darstellung von Hoovers weiterem Werdegang an bekannten Episoden:
Als Leiter des BOI setzt Hoover eine rigorose Professionalisierung seiner Behörde durch, die sich auf das idealisierte Berufsethos der „G-Men“ konzentrierte und gleichzeitig neuen kriminaltechnischen Methoden zum Durchbruch verhalf. 1925 wurde eine zentral verwaltete Kartei für Fingerabdrücke, ein kriminaltechnisches Labor und eine Aus- und Fortbildungsakademie etabliert. Gleichzeitig sorgte Hoover, dem die positive Darstellung des Gangsters im Kino missfiel, auf geschickte Werbung in eigener Sache. So wurde von Kaugummikarten bis zur TV-Serie „The FBI“ alles mögliche gesponsert, um seine Männer und sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Und dazu gehörten inszenierte Verhaftungen prominenter Mobster, die er selbst vornahm und die zuvor mediengerecht vorbereitet wurden.
Als Leiter des BOI setzt Hoover eine rigorose Professionalisierung seiner Behörde durch, die sich auf das idealisierte Berufsethos der „G-Men“ konzentrierte und gleichzeitig neuen kriminaltechnischen Methoden zum Durchbruch verhalf. 1925 wurde eine zentral verwaltete Kartei für Fingerabdrücke, ein kriminaltechnisches Labor und eine Aus- und Fortbildungsakademie etabliert. Gleichzeitig sorgte Hoover, dem die positive Darstellung des Gangsters im Kino missfiel, auf geschickte Werbung in eigener Sache. So wurde von Kaugummikarten bis zur TV-Serie „The FBI“ alles mögliche gesponsert, um seine Männer und sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Und dazu gehörten inszenierte Verhaftungen prominenter Mobster, die er selbst vornahm und die zuvor mediengerecht vorbereitet wurden.
Zwanghafte Selbstinszenierung
Die ineinander verschränkten
Zeitstränge führen in Eastwoods Film zu einer politisch interessanten dialektischen
Spannung zwischen dem 75-jährigen Hoover, der seine Memoiren diktiert, und dem
jungen Hoover, der am Anfang spürbar um seine innere und äußere Fassung ringt. Während
der alte Hoover im Prolog aus dem Off routiniert über das bedrohte Amerika
bramarbasiert, das von Kriminellen und mehr noch von Kommunisten bedroht wird,
die sich wie eine Infektion im Körper der Nation breit machen, muss sich der
junge Hoover erst noch konstruieren, um sich definieren zu können. Er spricht
gestelzt und aufgesetzt, um sich die notwendige Autorität bei seinen zum Teil
älteren Mitarbeitern zu verschaffen. Er mäkelt an äußeren Attributen seiner
Agenten herum („Keine Gesichtsbehaarung“) und zeigt früh seine Willkür, die in
späteren Jahren zur Obsession werden sollte. Und er folgt dem Rat seiner
Sekretärin und lässt seinen Sessel auf ein unsichtbares Podest stellen, damit
seine Besucher zu ihm aufblicken müssen. Von Anfang an wird klar, dass
Eastwoods Hoover seine Karriere als Teil einer Selbstinszenierung
begreift, die seine Identität mitsamt ihrer Bruchstellen verklammern soll.
Drei Menschen spielen in dieser
verkrampften Selbstinszenierung eine zentrale Rolle: Hoovers Mutter (Judy
Dench) als Objekt eines ödipalen Konflikts, sein späterer Stellvertreter und
Lebensgefährte Clyde Tolson (Armie Hammer) und seine Sekretärin Helen Grandy (Naomi
Watts).
Helen Grandy wird gleich zu
Anfang Hoovers holprigen Heiratsantrag ablehnen, aber das möglicherweise noch
intimere Angebot, nämlich seine Sekretärin zu werden, begeistert akzeptieren. Leider
gerät diese Figur dann weitgehend aus dem Fokus.
Alle drei aber haben etwas
gemeinsam: sie sind nicht nur durch ihre erotische Verzahnung mit Hoovers Leben
von Bedeutung, sondern sind auch ein Indikator für den gestörten Umgangs
Hoovers mit Intimität, deren Störungsanfälligkeit auf fast zwangshafte Weise Begehren und Manipulation
fast untrennbar miteinander vermischt. An ihnen wird durchdekliniert, was Hoover
umtreibt.
Kein Schwulendrama
Das alles lässt viel
Spielraum für Psychologie und möglicherweise auch für die psycho-analytische
Revision einer Figur, aus der die filmische Fiktion durchaus ein Monster
shakespearschen Ausmaßes hätte machen können.
Eastwood umschifft diese
Klippen mit einem fast diskreten und zurückhaltenden Regiestil, der lediglich Hoovers
Gesprächen mit seiner Mutter eine dezent angedeutete analytische Qualität gibt.
Diese finden häufig im Schlafzimmer statt, wo der junge Hoover vor einem
Spiegel steht, in dem er nicht nur sich selbst sieht, sondern auch seine
Mutter. Und der Zuschauer sieht beide.
Nicht zu Unrecht gilt der
Spiegel im Film als Symbol und Medium der Reflexion, aber auch der
narzisstischen Größenfantasie. Bei Eastwood wird er dagegen eher zum Reflex der
immer wieder erfahrenen Unzulänglichkeit und des mütterlichen Diktats. Vor dem
Spiegel stehend, empfängt der junge Edgar die unmissverständlichen, aber auch
ein wenig dunkel bleibenden Zurechtweisungen seiner Mutter, eine Konditionierung
hin zur Verdrängung des Unerwünschten, das nie beim Namen genannt wird, sich aber
im gequälten Gesicht DiCaprios ausdrückt. Hoovers Mutter fungiert dabei als
gelegentlich durchaus charmantes Über-Ich, das ihren Sohn zu Höchstleistungen
antreibt und eine eiserne Klammer der Disziplin über ihn verhängt.
Eastwood beschränkt sich
dabei auf drei Schlüsselszenen. In der ersten erzählt Hoovers Mutter ihrem Sohn
die Geschichte eines homosexuellen jungen Mannes, der Frauenkleider anzog, erwischt
wurde und sich kurz danach erschoss - eine „Narzisse“, durchaus ein elegantes Synonym
für Narzissmus und Homosexualität, und sie sagt Edgar, dass sie einen Sohn mit
so einer Veranlagung nicht dulden würde. Nach dem Tod der Mutter wird sich
Edgar deren Kleid anziehen und sich eine Perlenkette umhängen, jene
„Cross-Dressing“-Szene, die in den USA ausgiebig diskutiert wurde und die
Eastwood angeblich zunächst gar nicht zeigen wollte. So viel Symbolik könnte
schief gehen, aber Eastwoods Kunst besteht darin, so etwas weitgehend
unaufdringlich ins Bild zu setzen und mit seiner Kadrierung nicht zu viel Nähe
zu suchen.
Die Darstellung Clyde
Tolsons in „J. Edgar“ ist dagegen weniger komplex. Das überrascht ein wenig. Und
was noch wichtiger ist: sie spielt den ersten 60-70 Minuten des Films keine
nennenswerte Rolle.
Tatsächlich macht Eastwood
kein Geheimnis aus der sexuellen Orientierung der beiden Männer: Hoover sucht
Tolson gezielt nach Aktenlage aus, weil dort zu lesen ist, dass Tolson sich
nicht für Frauen interessiert.
Die dritte Schlüsselszene ist erste Begegnung der beiden. Hoover sitzt auf seinem erhöhten Podest, aber Tolson bleibt stehen und es ist Hoover, der aufblicken muss. Er sieht sich einem rhetorisch brillanten Upper-Class Anwalt gegenüber und ist entzückt und befangen zugleich. Später bindet er das Objekt der Begierde immer enger an sich, ohne nennenswerten Widerstand zu erfahren. Er macht ihn zu seinem Stellvertreter, er legt zärtlich seine Hand auf die von Tolson, er bucht ein Doppelzimmer für sich uns seinen Auserwählten, aber als er diesem gesteht, dass er nach einer „Mrs. Hoover“ suche (eine Anspielung auf die Hoover nachgesagte Affäre mit der Schauspielerin Dorothy Lamour), macht ihm Tolson eine Szene, nachdem er Hoover wortwörtlich gestanden hat, dass er ihn liebt. In der anschließenden Schlägerei der beiden küsst Tolson Hoover intensiv auf den Mund, dieser fährt ihn an: „Mach dies nie wieder!“, fleht Tolson aber an zu bleiben, nachdem dieser sich von ihm trennen will. Mit anderen Worten: Eastwood zeigt uns Hoover recht eindeutig als einen Mann, der einen ebenso eindeutig homosexuellen Mann an sich bindet, ohne aber den Mut zu finden, seine Gefühle auszuleben und zu dessen Inszenierung es gehört, eine Intimität so kontrolliert zuzulassen, dass sie am Ende keine mehr ist.
Die dritte Schlüsselszene ist erste Begegnung der beiden. Hoover sitzt auf seinem erhöhten Podest, aber Tolson bleibt stehen und es ist Hoover, der aufblicken muss. Er sieht sich einem rhetorisch brillanten Upper-Class Anwalt gegenüber und ist entzückt und befangen zugleich. Später bindet er das Objekt der Begierde immer enger an sich, ohne nennenswerten Widerstand zu erfahren. Er macht ihn zu seinem Stellvertreter, er legt zärtlich seine Hand auf die von Tolson, er bucht ein Doppelzimmer für sich uns seinen Auserwählten, aber als er diesem gesteht, dass er nach einer „Mrs. Hoover“ suche (eine Anspielung auf die Hoover nachgesagte Affäre mit der Schauspielerin Dorothy Lamour), macht ihm Tolson eine Szene, nachdem er Hoover wortwörtlich gestanden hat, dass er ihn liebt. In der anschließenden Schlägerei der beiden küsst Tolson Hoover intensiv auf den Mund, dieser fährt ihn an: „Mach dies nie wieder!“, fleht Tolson aber an zu bleiben, nachdem dieser sich von ihm trennen will. Mit anderen Worten: Eastwood zeigt uns Hoover recht eindeutig als einen Mann, der einen ebenso eindeutig homosexuellen Mann an sich bindet, ohne aber den Mut zu finden, seine Gefühle auszuleben und zu dessen Inszenierung es gehört, eine Intimität so kontrolliert zuzulassen, dass sie am Ende keine mehr ist.
Das Leben als Fake und der Mut zur Lücke
Dass dies in „J. Edgar“
nicht zu einem kolportagehaften Tuntendrama mutiert, liegt daran, dass es
Eastwood gelingt, das Homoerotische in Hoovers fiktiven Psychogramm immer als
Reflex auf dessen Selbstinszenierung zu zeigen. Innerhalb dieser
Mythologisierung zu Lebzeiten folgt den vermuteten Verdrängungen Hoovers immer
auch ein soziales und politisches Echo. Eastwood zeigt uns einen Mann, dessen
Bespitzelung Orwellsche Dimensionen erreicht und dessen Macht darauf basierte,
auf Tonbändern den Gesprächen von Menschen zu lauschen, die gerade Sex haben.
Eine rein psychoanalytische Ausdeutung des Ganzen als pathologische Obsession hätte uns
eine Portion Waschküchenpsychologie präsentiert, die aber kaum ernst zu nehmen
wäre. So wird das Innenleben Hoovers geschickt mit seinen erotischen Avancen,
seinen politischen Ängsten und Kontrollmanien verzahnt, ohne dass dies einer
billigen Kausalkette zugeschrieben wird.
Die eigentliche Pointe
serviert uns Eastwood am Ende , wenn „Alter Ego“ Clyde Tolson, gerade von einem schweren
Schlaganfall halbwegs genesen, seinem Freund die Rechnung
präsentiert: er habe mit seiner Autobiographie nicht nur maßlos übertrieben,
sondern schlichtweg gelogen. Die von Hoover inszenierte und mediengerechte
Festnahme eines Gangsters – ein Fehlschlag. Seine Bedeutung im Lindbergh-Fall –
kriminaltechnisch ein Erfolg, in der Selbstdarstellung eine grelle
Überzeichnung. Und so weiter.
Blitzschnell zeigt Eastwood
in kurzen Flashback, dass alles, was wir über den jungen Hoover erfahren haben,
lediglich eine Fiktion in der Fiktion gewesen ist. Wir haben nur die „Wahrheit“
gesehen, die uns der Off-Erzähler Hoover präsentieren wollte.
Nämlich die Inszenierung des Mythos.
Nämlich die Inszenierung des Mythos.
“If the legend becomes fact,
print the legend!” heißt es in John Fords „The Man Who Shot Liberty Valance“.
Nur besteht in Fords Klassiker der fromme Betrug darin, dass sich die öffentliche Wahrnehmung bei der Umwandlung der Fakten in den Mythos für eine historische Interpretation entscheidet, die ihr als die moralisch triftigere erscheint.
Nur besteht in Fords Klassiker der fromme Betrug darin, dass sich die öffentliche Wahrnehmung bei der Umwandlung der Fakten in den Mythos für eine historische Interpretation entscheidet, die ihr als die moralisch triftigere erscheint.
In „J. Edgar“ ist es das Subjekt des Mythos selbst,
dass diese Verwandlung betreibt.
In dieser Sollbruchstelle
der filmischen Narration legt uns Eastwood durchaus auch nahe, wie wenig den
Bildern zu trauen ist. Aber dies ist ja nichts Neues und wesentlich spannender erscheint
mir die Erkenntnis, dass Eastwood in seinem Biopic die Essenz eines
Lebensprinzips als kritisches Stilmittel adaptiert hat, um die Verzahnung des
Privaten mit dem Öffentlichen zu durchleuchten: ein Leben, das nur als eiserne
Inszenierung durchzuhalten ist, kann dem narzisstischen Subjekt nur gelingen,
wenn es am Ende die Fakten nicht veredelt, sondern verbiegt. Damit ist das Scheitern aber bereits beschlossene Sache.
Fast beschleicht einen das
Gefühl, dass Eastwood selbst ein wenig an dieser Schraube gedreht hat, denn
sein Film hat eine fast altmodische Art, anständig mit seiner Hauptfigur
umzugehen. Den Niedergang seines negativen Helden scheint uns Eastwood nämlich
ersparen zu wollen. Zwar wurde Hoover noch Mitte der 1950er von den
Republikanern ernsthaft als Präsidentschaftskandidat in Erwägung gezogen. In
den folgenden 15 Jahren vollzog das FBI dann aber einen aufsehenerregenden
Abstieg, der auf seinem Tiefpunkt die Behörde sogar die Konkurrenz mit
ländlichen Polizeistationen fürchten ließ. Wenige Jahre vor seinem Tod wurde
Hoover, der nach Ansicht einiger Historiker durchaus eine Blaupause für einen
amerikanischen Faschismus geliefert hatte, dann von dem Kongreßabgeordneten
Hale Boggs mit den Worten angegriffen, er bediene sich „der Methoden der
Sowjetunion und der Gestapos Hitlers.“
Das sehen wir in „Edgar J.“
nicht.
Auch nichts über die
Entwicklung des FBI zu einem innerstaatlichen Geheimdienst, nichts über die
Hoovers fast schon manische Fixierung auf die Verfolgung von Kommunisten und
Extremisten und genauso wenig über die Vorwürfe, Hoover habe gezielt die
Verfolgung des organisierten Verbrechens sabotiert, weil er mit der Mafia einen
Deal abgeschlossen wurde. Und noch weniger erfahren wir vom psychischen Abstieg
eines Mannes, der lange vor seinem Tod das FBI so abgewirtschaftet hatte, dass
man ihn nicht mehr ernst nehmen konnte, aber weiterhin fürchtete, und der einen
führenden Mitarbeiter in die Provinz versetzte, nur weil dieser ihm vor Antritt
einer Dienstreise „viel Spaß“ gewünscht hatte. Natürlich hat jemand wie Hoover
keinen Spaß während der Dienstzeit.
Und doch ist es konsequent,
denn das von Hoover Memorierte muss dort enden, wo der Höhepunkt erreicht ist:
in der Mittdreißigern - Hoover hat das FBI und er hat Tolson! Es ist der Moment
der größtmöglichen Kontrolle. Es ist der Höhepunkt der Inszenierung, in der
schon das Moment des Niedergangs angelegt ist. Und das erklärt die gewaltige
Lücke im Plot.
Und ganz am Ende, wenn
Hoover schon längst tot ist und Nixons Truppen vergeblich nach den in einem
verschlüsselten Karteisystem verborgenen Geheimdossiers suchen, deren Ort nur
noch Helen Gandy kennt, hören wir seine Stimme aus dem Off. Es sind die
gleichen Warnungen wie zu Anfang, nur haben sie einen Klang, der plötzlich eine
Nähe zu 9/11 und den Bush-Jahren aufscheinen lässt, so als würde der Tote dafür
werben, dass man heute einen wie ihn noch brauchen kann. Aber das ist wieder
nur eine Illusion.
Die Geschichte hat Hoover auf ganz andere Weise überholt, nur waren seine Nachfolger deutlich plumper.
Aber wesentlich gefährlicher.
Die Geschichte hat Hoover auf ganz andere Weise überholt, nur waren seine Nachfolger deutlich plumper.
Aber wesentlich gefährlicher.
Noten: BigDoc = 1
Anmerkung: Für diese Kritik habe ich in diversen Archiven recherchiert, weil ich bei Biopics immer wissen möchte, wo das Faktische aufhört und die Fiktion beginnt. Ich war verblüfft, dass in über den über 40 Jahre alten Dokumenten ziemlich exakt die Szenen und Episoden beschrieben wurden, die auch im Film zu sehen sind. Erwahnenswert ist, dass der alte Hoover ein ziemlich mieses Ekelpaket war. Einen anekdotischen Reiz besitzt auch folgende Episode: Hoover beschwerte sich eines Tages darüber, dass sein Fernsehgerät nicht funktioniere. Da er selten weitere Hinweise gab, sondern es seinen Mitarbeitern überließ herauszufinden, was er meinte, stürzte er alle in Panik. Irgendwann traute sich jemand nachzufragen. Und des Rätsels Lösung? Hoover wollte nach dem Drücken des Einschaltknopfes sofort (!) ein Bild sehen (Achtung: Röhrenfernseher!). Irgendwie haben die Jungs das dann für ihn hinbekommen.
Anmerkung: Für diese Kritik habe ich in diversen Archiven recherchiert, weil ich bei Biopics immer wissen möchte, wo das Faktische aufhört und die Fiktion beginnt. Ich war verblüfft, dass in über den über 40 Jahre alten Dokumenten ziemlich exakt die Szenen und Episoden beschrieben wurden, die auch im Film zu sehen sind. Erwahnenswert ist, dass der alte Hoover ein ziemlich mieses Ekelpaket war. Einen anekdotischen Reiz besitzt auch folgende Episode: Hoover beschwerte sich eines Tages darüber, dass sein Fernsehgerät nicht funktioniere. Da er selten weitere Hinweise gab, sondern es seinen Mitarbeitern überließ herauszufinden, was er meinte, stürzte er alle in Panik. Irgendwann traute sich jemand nachzufragen. Und des Rätsels Lösung? Hoover wollte nach dem Drücken des Einschaltknopfes sofort (!) ein Bild sehen (Achtung: Röhrenfernseher!). Irgendwie haben die Jungs das dann für ihn hinbekommen.